Persönliche Reaktionen auf die Krise
Autor: Mag. Günther Zier, Psychologe
Inhalt
Reaktionen auf die Krise
Persönliche Reaktion auf ein heftiges Ereignis
Schock
Stress, Stressor,
Stressreaktion des Körpers
Angst, Psychisches Trauma
Selbstmord, Die
"Logik" des Selbstmordes
Fragen nach
Selbstmord-Absichten?
Literatur zur Selbsthilfe
Verwendete
Literatur
 
In diesem Teil des Textes zur Krisenintervention werden
die Reaktionen der betroffenen Person auf die Krise beschrieben
Krise ist eine normale Reaktion
In einer Krise zu
stehen ist ein ganz normaler Zustand, zwar schmerzhaft, unangenehm und
frustrierend. Schwierigen Lebensumständen gegenüberzustehen und diese
versuchen zu überwinden, ist eine ganz normale Reaktion eines normalen
Menschen auf eine außergewöhnliche Situation.
"Zunächst einmal ist eine Krise
kein pathologischer Zustand; sie kann jedem Menschen in jeder Phase
seines Lebens begegnen.“ (Naomi Golan, 1983) Seite 62
Der Mensch, der mit
einer Krise belastet ist fühlt sich möglicherweise krank, aber die Krise ist
keine Krankheit und schon gar keine psychische Störung:
„’Krise’ meint eine länger
dauernde, aber immer noch zeitlich begrenzte Belastung mit der Chance eines
Wiedereinpendelns in einen (modifizierten) ‚Normalzustand’; unter einer
psychischen Störung im Sinne einer Neurose versteht man dagegen eine lang
anhaltende emotionale
Belastung mit ungewissem Ausgang." (Dieter Ulich, 1982a) Seite 185,186
Ein und dieselbe Lebenssituation wirkt auf
Menschen möglicherweise vollkommen verschieden. Der Eine bewältigt die
schwierige Lebenssituation mit ein wenig mehr Kraft und die gewohnten
Alltagsroutinen reichen.
Dem
Anderen macht die Krise
Kopfzerbrechen und mit erhöhter Anstrengung kann die schwierige
Lebenssituation gemeistert werden.
Ein
Dritter dagegen beißt sich an derselben Situation die Zähne aus,
verzweifelt und fällt in schwerste Depressionen, denkt vielleicht sogar an
Selbstmord. Literatur: (Naomi Golan, 1983)
Seite 62
Auch Richard Bandler & John Grinder betonen
den persönlichen Umgang mit der Krise:
"Fast jeder Mensch unserer
Kultur macht in seinem Lebenszyklus mehrere Zeiten der Veränderung und des
Übergangs durch, die er bewältigen muss. (...)
Erstaunlicherweise sind einige
Menschen fähig, diese Perioden der Veränderung mit geringen
Schwierigkeiten durchzustehen, indem sie diese Perioden als Zeiten
intensiver Energie und Kreativität erleben.
Andere, die mit derselben
Herausforderung konfrontiert werden, erleben diese Perioden als Zeiten
des Schreckens und des Schmerzes — Perioden, die ertragen werden müssen,
während es im wesentlichen nur um's Überleben geht." (Bandler,
Richard & John Grinder. 1981, Seite 34,)
So wie es aussieht, könnte man meinen, es käme nur auf die Persönlichkeit
des Betroffenen an. Könnte der Einsatz fast willkürlich gesteigert werden
und jede Krise könnte nur durch mehr Engagement und Hartnäckigkeit positiv
gelöst werden?
Nein! Denn es hängt von vielen Faktoren an, ob eine Krise erfolgreich
bewältigt werden kann. Für den Erfolg sind viele zusätzliche Einflüsse
notwendig, die meistens von außen kommen. Weiter hinten in diesem Text
werden die Faktoren einer erfolgreichen Krisenbewältigung beschrieben.
Einteilung der
Krisenanlässe
Die persönliche Reaktion auf ein
bedrohliches Ereignis hängt naturgemäß auch auf die Eigenheiten des
Ereignisses ab.
„Krisenanlässe lassen sich
grundsätzlich zwei Arten von Ereignissen zuordnen:
¤
Entweder hat ein Verlust oder eine erlittene
Schädigung stattgefunden. Das Ereignis ist irreversibel: Jemand hat
eine nahe Person verloren, ist Opfer eines Unfalls oder einer Gewalttat
geworden, ist schwer verletzt oder erkrankt, hat unwiderruflich in einer
Prüfung versagt etc.
¤
Oder eine Bedrohung oder Überforderung liegt vor bzw.
wird erwartet; zum Beispiel beruflicher oder familiärer Stress, drohende
Trennung vom Partner, Gefährdung des Arbeitsplatzes, Nötigung zu weitreichenden Entscheidungen. Aber auch der Druck entwicklungs- und
lebensgeschichtlichen Veränderungen, wenn sich Ziele widersprechen und
dadurch motivationale Konflikte entstehen, wird als Anlass zu einer Krise
angesehen.
Selbstverständlich gibt es Krisen, in
denen beide Formen der Krisenanlässe vorkommen, z. B. Verlust der Heimat und
drohende Ausweisung aus dem Gastland.“ Zitat: (Margarete Dross, 2001a, Seite
12)
Persönliche Reaktionen auf ein hartes Lebensereignis
Emotionaler Schock
(Link zur Erklärung:
Was ist ein "emotionaler Schock"?
)
Im Laufe des ruhigen, gewohnten
Lebens kann unerwartet und plötzlich ein schlimmes Ereignis auftreten, wie
z. B. Unfall, plötzlicher Tod eines nahen Verwandten od. Freundes, sowie
Naturkatastrophen. Die erste Reaktion der / des Betroffenen ist der
Emotionale Schock.
Plötzlich ist alles anders, das
altgewohnte Leben ist vorbei, nichts davon ist in absehbarer Zeit
wiedergutzumachen. Man glaubt, es trifft einem der Schlag, ist wie vom Blitz
getroffen.
Die sichtbaren Reaktionen auf den
Schicksalsschlag sind vielfältig: schreien, weinen, toben, herumschlagen,
umfallen, nach Luft ringen. Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein:
totale Ruhe, Sprachlosigkeit, wie gelähmt – nicht bewegen können. Manche
verlieren die Orientierung: Wissen nicht um die Zeit, nicht um den Ort und
auch nichts von ihrer ursprüngliche Tätigkeit vor dem schlimmen Ereignis.
Der erste Schock kann von wenigen
Sekunden bis mehrere Stunden dauern und durchläuft mehrere Phasen. Link:
Was ist ein "emotionaler Schock"?
Die Krise trifft den ganzen Menschen
Eine Krise trifft den ganzen
Menschen, sein gesamtes Denken wird vom Krisengeschehen ausgefüllt. Es fällt
sehr schwer, auch an etwas Anderes zu denken und seine Aufmerksamkeit auf
unproblematische Lebensbereiche zu richten. Das ständige Denken an den
Krisenauslöser macht es noch schwerer, kreative Lösungen für die Krise zu
finden.
Zitate aus der Literatur:
"Nach unserer Auffassung wirft jede Krise ein
grelles Licht auf die gesamten Bedingungen, Konflikte, unbewältigten
Probleme und traumatischen Fehlentwicklungen, auf die gesamte innere
Verfassung der Menschen: Es ist so, als hätte jemand den Teppich
weggezogen, unter den bisher alles gekehrt worden ist. Gefühle, die
blockiert oder verdrängt waren, Energien, die »geronnen oder eingefroren«
waren, brechen plötzlich auf." (Monika Schnell und Helmut Wetzel, 2000)
Seite 1710
"Im Zustand der Krise, die vom Konzept her
ebenfalls vorübergehender Natur ist, ist nun die gesamte Person betroffen.
Die Zielbezogenheit und Kontinuität „normaler" Erlebens- und
Handlungsverläufe sind ernsthaft gefährdet oder unterbrochen. Die
eigenen Mittel sind (zumindest vorübergehend) erschöpft; oft ist Hilfe von
außen erforderlich. Eigene Anstrengungen
werden nicht für unbedingt erfolgversprechend gehalten, es kann Hilflosigkeit
oder gar Hoffnungslosigkeit entstehen. In einer Krise kann auch Verzweiflung
auftreten. " (Dieter Ulich, 1982b)Seite 191,192
Die Krise erzeugt Stress
Stress ist die typische, allumfassende Reaktion auf
eine Krise!
Auf Bedrohung oder Verlust reagieren Menschen. Diese
Reaktion wird als „Stress“ bezeichnet. Die Stressreaktion ist uns angeboren
und hilft uns, gefährliche Lebenssituation zu meistern. Stress ist an sich
nichts Schlimmes, unser Körper kann zur Bewältigung von gefährlichen
Situationen eine Menge Reserven in die Schlacht werfen – allerdings darf der
Stress nicht zu lange andauern, schon gar nicht zum Dauer-Stress werden.
Stress ist ein zusätzlicher Störenfried in einer
Krise. Aus der Sicht des Verfassers wird der Faktor Stress zu wenig beachtet
und gedämpft. Vermutlich ist Stress der Hauptverursacher für die schlechte
Befindlichkeit in einer Krise. Nicht nur das Stress-auslösende Ereignis
hindert den Betroffenen an einem ruhigen gewohnten Weiterleben, sondern
zusätzlich halten die Stressreaktionen den Betroffenen noch auf Trab und
blockieren kreative Problemlösungen. Stress reduziert die geistige
Leistungsfähigkeit und verkürzt auch die ohnehin knappen Erholungsphasen.
Was ist Stress?
Wann immer der Mensch mögliche
oder wirkliche Gefahren wahrnimmt oder auch nur vermutet, aktiviert sein
Körper ein Alarmsystem. Diese Aktivierungsreaktion ist im Organismus
biologisch vorgegeben, und stellt dem Organismus alle seine
Abwehrmechanismen und -kräfte bereit. Damit ist er auf eine möglicherweise
bevorstehende Flucht oder einen Kampf in vorbereitet.
(Brockhaus, 2004) Seite 1
Die Wahrnehmung einer Gefahr ist
das Wichtigste am Stressgeschehen. Der Mensch muss eine Situation als
gefährlich wahrnehmen, dann setzt die innere Stressreaktion ein. Ohne
bewusstes Zutun versetzt sich der Organismus automatisch in einen
Alarmzustand, um die Situation zu bewältigen.
Was genau versteht man unter „Stress“?
Stress ist ein
psycho-biologischer Zustand des Organismus und zeigt sich in einer Gruppe
zusammengehöriger Phänomene. Diese Gruppe wird als „allgemeines
Adaptationssyndrom“ (AAS) bezeichnet.
Was ist ein „Stressor“?
Die Situation, oder das Ereignis, welches eine
Stress-Reaktion im Körper auslöst wird als Stressor bezeichnet. Ein
Stressor ist irgendetwas, das dem Organismus Schaden zufügt, ganz gleich, ob
dieser physischer (z.B. Hunger, Schlafmangel, Verletzung) oder psychischer
Natur ist (z.B. Liebesverlust oder Mangel an persönlicher Sicherheit).
Stress-Reaktion des Körpers
Die Stress-Reaktion des Körpers wird in 3 Hauptphasen
eingeteilt:
¤
die Alarmreaktion,
¤
die Phase der Resistenz
¤
die Phase der Erschöpfung.
1.) Die Alarmreaktion – auch
Notfallreaktion genannt – ist die erste Reaktion auf Stressor (=Stress-provozierenden
Reiz).
Der Körper reagiert sehr rasch auf einen Stressor mit
verschiedenen komplizierten körperlichen und biochemischen Veränderungen. Es
werden Stress-Hormone ausgeschüttet, die dem Körper mehr Kraft geben und
seine Verletzbarkeit verringern.
Zusammengenommen sind diese Veränderungen immer die
Gleichen, egal welcher Stressor auftritt. Ob Verlust eines Angehörigen, oder
die drohende Geldstrafe bei einem Verkehrsdelikt, immer wird im Körper die
gleiche Stressreaktion ablaufen.
Dies erklärt auch, warum die Menschen unter sehr
ähnlichen allgemeinen Symptomen leiden, selbst wenn sie ganz verschiedene
Krankheiten haben. Alle Welt klagt dann über Kopfschmerzen, Fieber,
Müdigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen, Appetitmangel und allgemeine
Erschöpfung.
2.) Phase der Resistenz
Hält die stressverursachende Situation weiter an,
folgt auf die Alarmreaktion die Phase der Resistenz. (die
zweite Phase des allgemeines Adaptationssyndroms). Der Organismus scheint
nun einen Widerstand gegen den spezifischen Stressor, der die
Alarmreaktionen auslöste, zu entwickeln. Die im ersten Stressstadium (Alarmreaaktion)
aufgetretenen Symptome verschwinden, obgleich die störenden Einflüsse weiter
bestehen.
3.) Phase der Erschöpfung
Hält die schädigende Einwirkung des Stressors zu
lange an, kann der Organismus dem Stressor nicht länger widerstehen. Damit
setzt das letzte Stadium, die Phase der Erschöpfung, ein. Die
Hormondrüsen können wichtige Stresshormone nicht mehr in ausreichenden
Mengen produzieren, dadurch kann sich der Organismus dem Dauerstress nicht
mehr anpassen.
Viele der in der Alarmreaktionsphase aufgetretenen
Symptome treten jetzt erneut auf.
„Wirken
die Stressfaktoren dauerhaft auf den Menschen ein, führt dies zu
funktionellen Entgleisungen wie Erhöhung des Blutdrucks, Schlaflosigkeit,
Magensaftüberproduktion und vegetativen Störungen. Folgekrankheiten
können Bluthochdruck, Magengeschwüre und eine verminderte Durchblutung der
Herzkranzgefäße sein.“ (Brockhaus, 2004)
Wirkt der Stressor noch länger auf den Organismus ein,
so kann der Tod die Folge sein. Dauerstress macht den Menschen krank und
über lange Zeit führt er indirekt zum Tod.
In den weitaus meisten Fällen wird der Stress jedoch
reduziert, bevor der Zustand totaler Erschöpfung erreicht,
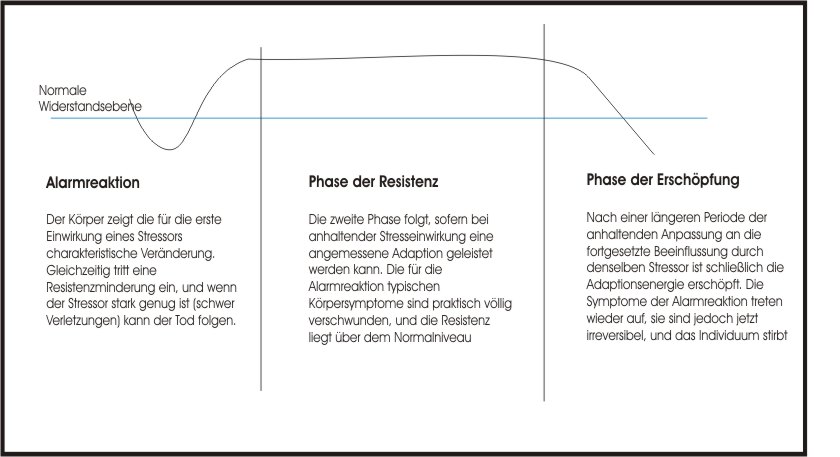
Bild: Das allgemeine Adaptionssyndrom (nach Seyle,
1956)
Literatur (P.G. Zimbardo & Angermeier, Wilhelm F.,
1983) Seite 460
Stressablauf an anhand eines Beispiels: Wie ein
urzeitlicher Jäger auf eine Bedrohung reagiert:
Stressreaktion
Angst
Auf ein krisenauslösendes Ereignis reagieren die
meisten Menschen mit Angst. Das ist eine natürliche Reaktion und soll den
Menschen zur Flucht treiben.
Angst entsteht automatisch und ist Teil eines
biologisch angelegten Programms, um unser Überleben zu sichern.
Angst in der besonders intensiven Form wird als
„Panik“ erlebt. Wenn das bedrohliche Ereignis deutlich wird, oder als
besonders gefährlich erlebt wird, treibt einem die Panik zur Flucht. Oft
ist die Flucht aber nicht möglich. Die meisten krisenauslösenden Ereignisse
in unserer Zivilisation können nicht mit Flucht bereinigt werden. Man kann
der drohenden Arbeitslosigkeit oder der tatsächlich ausgesprochenen
Kündigung nicht davonlaufen.
"Die
Angst hemmt, kann alle an der Krisenintervention Beteiligten hemmen."
(Verena Kast, 1987) Seite 25
"Durch das Gespräch (Krisenintervention, Anm. G.
Zier) wurde sie etwas angstfreier, und kaum hat sie etwas weniger Angst,
kann sie kreativ werden. Angst blockiert unsere kreativen Prozesse."
(Verena Kast, 1987) Seite 51
"Sorgen- und Grübelprozesse enthalten
angst-induzierende und erregungsreduzierende Anteile: einerseits beschäftigt
man sich mit Bedrohungen, andererseits werden konkrete anschauliche
Vorstellungen des Bedrohlichen durch ausschließlich gedankliche
Wiederholungen vermieden, Sich-Sorgen wirkt also in sich negativ verstärkend
(Borkovec, 1994). Besorgnis gaukelt vor, man arbeite an einer
Lebensschwierigkeit, während in Wirklichkeit eine Lösung vermieden wird."
(Margarete Dross, 2001b) Seite 52
Durch Grübeln und das ständige Gedankenkreisen um das
krisenauslösende Ereignis wird die ständige Angst aufrechterhalten und noch
verstärkt. Ein Ausweg ist ohnehin nicht in Sicht, aber unser biologisches
Programm zwingt uns, sich ständig mit dem bedrohlichen Ereignis zu
beschäftigen. Diese Gedanken halten ein hohes Angst-Niveau aufrechte – an
Ruhe ist nicht zu denken. Das biologische Programm läuft weiter, obwohl objektiv
betrachtet, der Schlag längst vorbei ist. Die Gedanken an den Stressor
erzeugen ständig Angst und lösen damit eine Stressreaktion aus. Der Mensch
kann sich nicht erholen und das Kräfte-Sammeln wird gestört.
Psychisches Trauma
Bei besonders harten krisenauslösenden Ereignissen
kann ein psychisches Trauma entstehen.
Diese Ereignisse können sein:
-
körperliche Misshandlung, die eigenen Bedrohung von
Leib und Leben,
-
Mitansehen von schweren Verletzungen und den Tod
Anderer.
Was ist ein psychisches Trauma?
Zitat:
"Ein Trauma
ist die Verletzung und nachhaltige Schädigung einer bestehenden
Struktur. Das betrifft den körperlichen Bereich (z.B. Schädel-Hirn-Trauma,
Polytrauma) ebenso wie den psychischen. Die Art des Ereignisses und die
näheren Umstände spielen dabei ebenso eine Rolle wie die Personen,
die davon betroffen sind, und die Folgen, die daraus auf den verschiedensten
Ebenen (psychisch, körperlich, sozial, finanziell usw.) entstehen." (Clemens
Hausmann, 2003a) Seite 59
Welche Schadereignisse können zum Trauma führen?
„Traumatische Ereignisse sind zumeist plötzlich
auftretende Umstände oder Situationen, die auf den Betroffenen sehr
bedrohlich wirken und akute traumatische Reaktionen, sowie längerfristige
psychische Symptome und Störungen verursachen können.“ (Clemens Hausmann,
2003a) Seite 59,60
Beispiele:
„Die häufigsten Traumata waren körperliche Gewalt
(9,6%), schwere Unfälle (7,5%) und Zeuge sein von Unfällen oder Gewalt
(4,2%), gefolgt von sexuellem Missbrauch in der Kindheit (1,9%) und
Vergewaltigung“ (1,3%) (Perkonigg et al., 2000; Maercker, I997a). in
(Clemens Hausmann, 2003a) Seite 61
Besonders schwere Traumata entstehen durch
willentlich von anderen Menschen verursachte Gewaltakte, wie Missbrauch,
Folter, Terroranschläge und andere sowie länger andauernde oder sich
wiederholende Traumata.
Die am stärksten belastenden
Traumata sind für Frauen wie Männer Vergewaltigung und sexueller Missbrauch.
(Clemens Hausmann, 2003a) Seite 61
Ein psychisches Trauma gehört zu den schwersten
Schäden, die durch ein krisenverursachendes Ereignis ausgelöst werden
können. Es entstehen daraus schwere psychische Schäden. Schwere
Wahrnehmungsstörungen, Halluzinationen, Depressionen und Wahnvorstellungen
sind möglich. Auffallend sind auch die vielen Störungen des Verhaltens im
sozialen Kontakt.
Ein besonderer Fall der
Traumatisierung ist eine Katastrophe. Fast alle Menschen eines Landstriches
werden mit dem schrecklichen Ereignis belastet. Zusätzlich sind die Menschen
lange Zeit mit der Zerstörung konfrontiert und in absehbarer Zeit ist keine
Verbesserung der Lebenssituation in Sicht. Siehe Text zum Thema Katastrophe:
Link Das Wesen
einer Katastrophe
Weitere Literatur und Selbsthilfe zum Überwinden
traumatischer Erlebnisse:
Herbert, Claudia,
Wetmore, Ann und Erckenbrecht, Irmela,
Wenn Albträume wahr
werden- traumatische Ereignisse verarbeiten und überwinden,
Bern: Huber, 2006.
Selbstmord
Selbstmord wird von vielen Fachleuten auch als
„Suizid“ bezeichnet.
Erklärung: "Suzid"
Eine Lebenssituation kann für manche Menschen so
schwierig werden, dass sie an einen Freitod denken. Die Verzweiflung kann
schlimm werden, so schlimm, dass nicht der geringste Ausweg erkannt wird und
die Situation nicht mehr zum Aushalten ist.
Freiwillig aus dem Leben zu scheiden und so allen
Belastungen ein Ende zu setzen, erscheint dann als realistischer Ausweg.
Suizid wird dabei als endgültige Lösung für ein zumeist vorübergehendes
Problem gesehen. (Clemens Hausmann, 2003b) Seite 167
Selbstmordgefährdung
Wann ist ein Mensch
selbstmord-gefährdet? Auch hierzu gibt es einen Fachbegriff: „suizidal“.
Wann muss man an einen Verdacht auf Suizidalität denken?
"Suizidal ist, wer von
Selbstmord spricht, entsprechende Andeutungen macht oder Besorgnis
auslöst. Auch bei geringem Verdacht ist nach Suizidgedanken und -plänen zu
fragen. Professionelle Helfer sind verpflichtet, bei akuter Gefährdung
Hilfe zu leisten." (Manuel Rupp, 2003) Seite 115.
"Ein „Verdacht auf Suizidalität" ist gegeben, wenn uns im
Kontakt mit einem hilfesuchenden Menschen die Frage auftaucht, ob der
betreffende „vielleicht suizidal" ist." (Manuel Rupp, 2003) Seite 123.
Die Ankündigung eines Selbstmordes
ist immer Ernst zu nehmen!
Für die Einschätzung der
Gefährdung zum Selbstmord gibt es einige wichtige Hinwese. Im Wesentlich
lassen sich aus dem Leben vor der Krise Hinweise auf die Möglichkeit zum
Selbstmord schließen, daraus werden Risikofaktoren erkannt. Diese Erhöhen
die Wahrscheinlichkeit, bei größeren Lebensproblemen sich das Leben zu
nehmen.
Die Logik des Selbstmordes
Selbstmord erscheint uns oft als vollkommen fremd und
unverständlich. Aber so ist es nicht. Selbstmord ist keineswegs eine bizarre
und unverständliche Tat der Selbstzerstörung. Im Gegenteil: Selbstmörder
verfügen über eine in sich schlüssige Logik. Da läuft einen Denkstil, der
sie zu dem Schluss führt, der Tod sei die einzige Lösung für ihre Probleme.
Dieser Denkstil wurde erkannt.
Der amerikanische Psychologe, Prof. Edwin Shneidman
forschte 40 Jahre lang am Phänomen „Selbstmord“. (Literatur:
Edwin Shneidman, 1988, Seite 29-31.)
Er hat 10
Merkmale, die zum Selbstmord führen, gefunden:
1) Unerträgliche psychische Schmerzen: Niemand begeht
Selbstmord aus einem positiven Gefühl heraus. Selbstmord ist das Ergebnis
großer Erschöpfung und Pein. Der Schmerz macht das Leben zur Hölle, und vor
diesen Schmerzen will der selbstmordgefährdete Mensch fliehen.
2) Frustrierte psychologische Bedürfnisse: Sicherheit,
Vertrauen, Freundschaft und Erfolg bestimmen in hohem Maße unser Innenleben
und kommen in entsprechenden Bedürfnissen zum Ausdruck. Es gibt niemals
einen Selbstmord, der nicht aus frustrierten Bedürfnissen heraus unternommen
wird. Wenn die Frustration der nicht-erfüllten Bedürfnisse unerträglich
wird, kommt es zum Selbstmord.
Link:
Erklärung: Was ist "Frustration"
3) Die Suche nach einer Lösung: Selbstmord wird als ein
Ausweg aus einem Problem, einer Krise, einer unerträglichen Situation
gesehen. Der Betroffene fand nur ihn als einzige Antwort auf die zentrale
Frage: „Wie komme ich aus dieser Lage heraus?".
4) Der Versuch, das Bewusstsein zum Schweigen zu bringen:
Selbstmord ist eine Flucht vor dem Schmerz und der Versuch, das Bewusstsein
endgültig zu verlieren. Das Ziel des Selbstmordes ist es, das
Wahrnehmen-Müssen einer schmerzhaften Existenz zu beenden.
5) Hilf- und Hoffnungslosigkeit: Im Erleben der
Verzweiflung liegt auch noch das tiefere Gefühl der Macht- und
Hilflosigkeit. Besonders großen Raum nimmt die Überzeugung, dass nichts und
niemand gegen diese Schmerzen helfen kann. Nur der Selbstmord könnte helfen.
6) Einengung der Lösungsmöglichkeiten: suizidale Menschen
denken nur noch in zwei Lösungsmöglichkeiten: Die totale Lösung oder das
totale Nichts, auch Alles oder Nichts. Die vielen machbaren Lösungen,
zwischen Alles oder Nichts, werden nicht gesehen und nicht akzeptiert.
Verzweiflung und Schmerz hat den Menschen zu dieses Denkschema gebracht.
Weil aber das Beste, das Einzige und das einzige „Richtige“ nicht erreichbar
ist, gibt es nur mehr eine Lösungsmöglichkeit: den Tod
7) Ambivalenz:
(Was heißt "Ambivalenz"?)
Das
gleichzeitiges Bestehen entgegengesetzter Gefühle (Abneigung — Zuneigung)
und Willensrichtungen in Bezug auf denselben Gegenstand ist bis zu einem
gewissen Grad vollkommen normal. Wir alle lieben und hassen einen
Elternteil, einen Partner, ein Kind - aber ein suizidaler Menschen pendelt
zwischen Leben und Tod. Die selbstmörderische Situation ist typisch: Ein
Mensch schneidet sich die Adern auf und ruft gleichzeitig um Hilfe.
Psychologisch gesehen sind beide Handlungen echt.
8) Die
Mitteilung der Absicht: Sehr viele selbstmordgefährdete Menschen geben
Freunden und/oder Familienangehörigen Hinweise über ihre Suizid-Absicht.
Ihre
Hilflosigkeit wird geäußert, um dramatisch um Reaktionen wird gebeten.
Selbstmorde sind eigentlich keine Akte der Feindseligkeit oder der Rache,
sondern Versuche, andere dazu zu bewegen, den Schmerz des Selbstmörders zu
erkennen und ihn vom Selbstmord abzuhalten.
Die
Selbstmordbereitschaft wird auf verschiedenen Ebenen ausgerückt:
Sprachlich durch die ausgesprochene Ankündigung. Auf der Verhaltensebene
durch verschiedene Vorbereitungen, wie wertvolle Dinge weggeben, oder in
auffälliger Weise werden seine Angelegenheiten geordnet.
9)
Abschied: Selbstmord ist der endgültige Abschied, eine radikale und
permanente Veränderung der Lebensbühne.
10) Problemlösungs-Muster im
bisherigen Leben:
¤
Die frühre Art und Weise, wie Probleme gelöst wurden
und wie psychische Schmerzen ertragen wurden, sind Vorzeichen einer
Selbstmordgefährdung in schweren Krisen.
¤
Der Hang zum „Entweder-Oder-Denken“ ist ein
gefährlicher Vorbote für mangelnde Problemlösefähigkeiten.
¤
Auch das von früher gewohnten Abschieds-Muster lässt
sich als Zeichen eines hohen Suizid-Risikos deuten.
Zum Beispiel: Wenn jemand beispielsweise einen Job hinwirft, bevor er
gekündigt wird; wenn jemand seinem Ehepartner einfach davonläuft,
anstatt sich dem Scheidungsprozess zu stellen; oder wenn jemand einen
Problemlösungs-Stil entwickelt hat, der als „zuschlagen und weglaufen"
charakterisieren werden kann,
Sind all diese
Verhaltensweisen in der Vergangenheit aufgetreten, lässt sich annehmen,
dass der Betroffene in einer Krisensituation zum Selbstmord neigt.
Kombination der zehn Merkmale
Keines dieser zehn
Merkmale ist alleine für sich genommen explosiv, aber wirken mehrere
gemeinsam, sind sie tödlich. Auch ist es leichter einen Menschen aus der
Selbstmordabsicht herauszuholen, wenn nur wenige der zehn Merkmale
auftreten. Sind alle zehn in der Situation des Betroffenen vorhanden, ist es schwer, den Suizid zu verhindern – aber trotzdem möglich.
Literatur: Shneidman, 1988, Seite 29-31.
Gespräch über Selbstmordabsichten
Das Reden mit dem / der
Betroffenen über Selbstmordabsichten ist sehr wichtig, es ist unerlässlich
abzuschätzen, wie weit Selbstmordpläne entwickelt wurden. Die Frage „Denken
Sie daran, sich umzubringen“, ist unumgänglich.
Oft wird befürchtet, diese Frage
könnte erst den verzweifelten Menschen auf die Idee bringen, sich das Leben
zu nehmen. Das ist aber nicht so! – Durch das Fragen nach der Suizidalität
(Erklärung: "Suzid")
wird normalerweise kein Mensch in den Selbstmord getrieben.
Viel mehr empfinden suizidale
Menschen das wichtige Gefühl des Verstanden-Werdens. Ihre Hoffnungslosigkeit
und Einsamkeit wird gemildert: Da ist ein Mensch, der sich für Einem
interessiert und das Wichtigste auch ausspricht!
Der Rahmen für ein Gespräch über
die Selbstmordabsichten muss stimmen. Dazu braucht es Zeit, den richtigen
Ort und die richtige Situation. An die Frage nach den Selbstmordabsichten
muss sich der Helfer behutsam vortasten und zuvor eine Vertrauensbasis
geschaffen haben. Mit den Antworten auf die Frage muss vertrauensvoll
umgegangen werden.
Äußerungen, die als Anzeichen für Suizidalität
(Erklärung: "Suzid")
interpretiert werden
können:
¤
„Ich kann das nicht mehr ertragen." „Es war schon immer zu
viel, aber jetzt geht es gar nicht mehr." „Ich mache das nicht mehr mit."
„Ich möchte alles hinschmeißen." (bedeutet: Überlastung)
¤
„Mein Leben ist sinnlos geworden." „Es lohnt sich nicht mehr."
„Alles, wofür ich gelebt habe, ist jetzt verloren." (bedeutet:
Sinnlosigkeit)
¤
„Es wird nie besser werden." „Die Zukunft ist wie ein
schwarzes Loch." „Ich weiß wirklich nicht, was ich noch tun kann."
(bedeutet: Hoffnungslosigkeit)
¤
„Ich falle allen zur Last." „Ich bin völlig nutzlos."
(Depressivität) „Irgendwann mal ist es zu spät." „Die werden sich noch
wundern." „Wenn ich nicht mehr da bin, dann ..." (bedeutet:
Interaktionelle Suizidmotive)
¤
„Ich möchte nur noch meine Ruhe haben." „Die Mühle kann nicht
ewig so weitergehen." „Wenn ich nur einschlafen könnte und nicht mehr
aufwachen würde." (bedeutet: Wunsch nach Ruhe)
Literatur: (Margarete Dross, 2001c) Seite 57
Falsches und Richtiges zum
Selbsmord. Link:
Falsches-Richtiges zum Selbstmord
|
